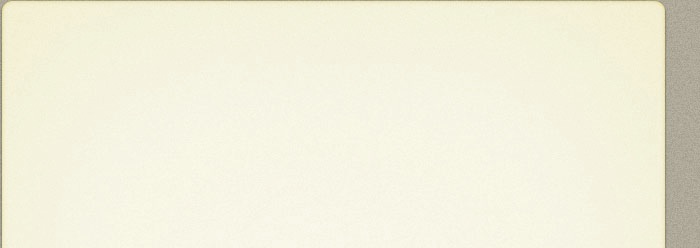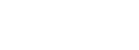Die Verpfändung des Egerlandes
Nach dem Aussterben der Přemysliden im Mannesstamme wurde 1310 Johann von Luxemburg mit Böhmen belehnt. In den folgenden Thronauseinandersetzungen im Reich spielten die Luxemburger eine entscheidende Rolle. In dem Streit mit Friedrich den Schönen versicherte sich Ludwig der Bayer die Unterstützung Johanns mit dem Versprechen, diesem Stadt und Land Eger sowie die Reichsburgen Floß und Parkstein als Pfand zu überlassen. Das schon 1315 gegebene Versprechen wurde schließlich mit einer am 4. Oktober 1322 in Regensburg ausgestellten Urkunde realisiert. Das Rücklösungsversprechen konnte von Ludwig dem Bayer infolge der veränderten politischen Lage nicht mehr eingelöst werden. Der Sohn König Johanns, Kaiser Karl IV., wandelte die persönlich an Johann gegebene Pfandschaft in eine an die Krone Böhmens. Die Verpfändung von Stadt und Land Eger war ein bedeutsamer Einschnitt in der Gesamtentwicklung des aus der nordgauischen Region Eger erwachsenen staufischen Egerlandes.
Die Verpfändung des Egerlandes an den Böhmenkönig Johann von Luxemburg erfolgte nach Absprache mit der für das Egerer Territorium maßgebenden Reichsstadt Eger. Die Forderung Egers nach Unabhängigkeit des Pfandlandes vom Königreich Böhmen während der Pfandschaft wurde in der am 23. Oktober 1322 in Prag ausgestellten Urkunde voll und ganz berücksichtigt. Im einzelnen wurde festgelegt, daß alle überkommenen Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, der Status einer Reichsstadt auch in Zukunft ohne Beeinträchtigung gelten. Das Gebiet insgesamt sollte erhalten bleiben und nichts davon an Böhmen abgetrennt werden; die Organe des Königreiches Böhmen dürfen sich in die Rechte des Pfandlandes nicht einmischen; es darf weder eine böhmische Königssteuer noch die allgemeine Landessteuer gefordert werden; auch sollte Eger nicht dem obersten Landesbeamten in Böhmen zugeordnet sein. Die Juden, die in Böhmen dem dortigen Kammergericht unterstanden, bleiben dem Pfandland zugeordnet. Auch wird zugesichert, daß Eger nicht weiter verpfändet wird. "Durch die ihrem Inhalte nach als ein staatsrechtlicher Vertrag zu wertende Urkunde war die Stellung Egers als ein eigenständiges und verfassungsrechtlich vom Königreich Böhmen unabhängiges Reichsland statuiert" (Sturm: Districtus Egranus, S. 72).