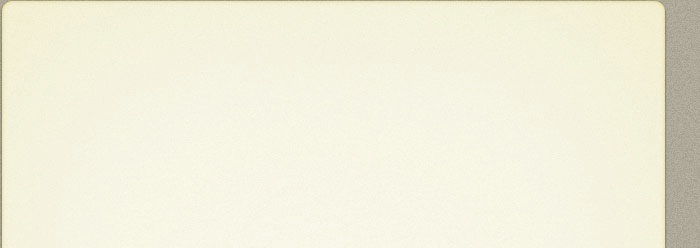Der Dreißigjährige Krieg
Gleich zu Beginn der Zwanzigerjahre des 17. Jahrhunderts begannen sich die unmittelbaren Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges (1618 - 1648) abzuzeichnen, obwohl Eger während der böhmischen Rebellion und auch gegenüber dem Winterkönig Friedrich von der Pfalz (Führer der protestantischen Union im Reich, 1919 von den prot. Ständen Böhmens zum böhm. König gewählt) mit politischem Geschick eine streng neutrale Haltung einnahm. Dafür erhielt Eger am 23. Mai 1623 eine Urkunde ausgestellt, kraft derer den Egerern "dasjenige, worin sie in zeit gewester rebellion den sachen zu viel gethan oder zu weit gegangen sein möchten," verziehen wurde. Diese Generalamnestie für nichtbegangene Verfehlungen kostete die beträchtliche Summe von 10 000 Gulden. Wegen seiner Lage am nordwestlichen Eingangstor nach Böhmen war es unausweichlich, daß Stadt und Land während der drei Jahrzehnte des Kriegsgeschehens immer wieder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Eger wurde ein Stützpunkt für die Kriegsrüstung und ein Sammelplatz der kaiserlichen Truppen. Albrecht von Wallenstein bestimmte noch als Obrist im Jahre 1622 Eger zum Waffenlager für die Aufrüstung seiner Kontigente. Dessen Ermordung im Jahre 1634 in Eger ist wohl das bekannteste historische Datum die Stadt betreffend. Schließlich am 5. Dezember 1640 schrieben die Egerer an Kaiser Ferdinand III.: "Ein Stein könnte sich erbarmen, was wir schon alles erlitten und ausgestanden haben, ein Drittel der Stadt ist abgebrannt, nur rudera (Trümmer) sind vorhanden, noch liegen die drei Vorstädte in Aschen. Kaum hundert angesessene Bürger sind noch hier, täglich verlassen andere die Stadt. Die Dorfschaften sind verödet, acht in Brand gesteckt. Was Bürger und Bauer am Leibe tragen, ist ihr einzig Hab und Gut, alles ist am Bettelsack gebracht. Um der heiligen, bluttriefenden fünf Wunden Christi willen, bitten wir Eure Majestät, uns von weiteren Gräueln zu verschonen."
Die im Exil verbliebenen Egerer strebten - wie oben schon erwähnt - nach Wiederherstellung des reichsstädtischen Charakters von Eger. Im Jahre 1645 richteten sie ein Memorandum an den Kaiser, des Inhalts, die stadt Eger in ecclesiasticis et politicis in vorigen stand völlig wiederum restituieren zu lassen, zumal Eger 1641 auf dem Reichstag in Regensburg ohne sein Zutun den zu restituierenden Reichsgliedern zugezählt worden sei. Weiter schlugen sie vor, daß die Pfandschaft Eger sich selbst auslösen dürfe. Sie fanden zwar Rückhalt bei den protestantischen Reichsständen und den Städten, die kaiserlichen Abgesandten vertraten jedoch in der Egerer Frage allein die habsburgische Hausmachtpolitik und setzten sich damit in Widerspruch zu den Reichsinteressen. Die Stadt Eger selbst, mittlerweile überwiegend katholisch, war für die Interessen der protestantischen Exilanten keine Hilfe. Sie bemühte sich zwar, wieder in die Reichsmatrikel aufgenommen zu werden, aber auch dagegen sperrten sich die Kaiserlichen. Die prostestantischen Reichsstände gaben schließlich in der Frage der Stellung Egers nach, da sie sonst den Abschluß des langwierig ausgehandelten Friedensvertrages gefährdet hätten.
Der Westfälische Friede brachte für Eger nun die Einsicht, daß der generationenlange Kampf um Wiedereinlösung zum Reich vergeblich war; da nun mit der Habsburger Dynastie Pfandnehmer und Pfandgeber vereinigt waren, überwogen die Interessen des Pfandnehmers. Umso nachdrücklicher setzte die Statthalterei in Prag ihre Bemühungen fort, Stadt und Land Eger in eine enge Verbindung zu Böhmen zu bringen.