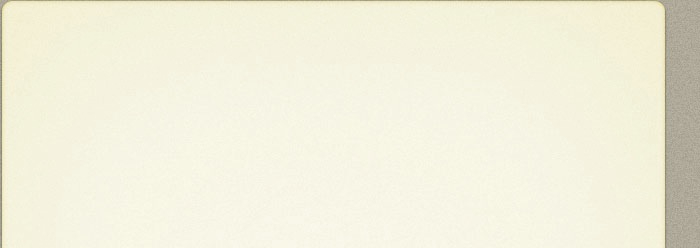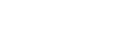Die 1. Republik
Die bei gewaltlosen Demonstrationen gegen die Einbeziehung in die geplante "Tschechoslowakei" erschossenen Deutschen mußten wohl das Verhältnis zum "Staatsvolk" genauso belasten wie die unbedachte Äußerung Masaryks von den - seit annähernd tausend Jahren in Böhmen wohnenden - Deutschen als "Immigranten und Kolonisatoren", was abwertend gedacht war; oder auch die Tatsache, daß die Polen, Ungarn, Ruthenen an der Verfassung unbeteiligt waren und in der Einleitung lesen durften: "Wir, das Tschechoslowakische Volk ..." Es war für die Gegenwart nicht hilfreich, daß, wie Beneš noch in seinen Memoiren schrieb: "... die Tschechisierung unserer deutschen Gebiete vollzieht sich automatisch durch den natürlichen Bevölkerungsaustausch und die Vermischung der deutschen und tschechischen Bevölkerung ...". Trotzdem setzten sich bei den Deutschen und Tschechen diejenigen durch, die in dem neuen Staat friedlich zusammenleben wollten. Die als "Aktivisten" bezeichneten deutschen Parteien begannen 1925 mit einer vorsichtigen Zusammenarbeit mit den tschechischen; zwischen 1925 und 1935 standen etwa 75 bis 85 Prozent der deutschen Wähler hinter den aktivistischen Parteien. Doch die "Republik" konnte aus vielfältigen Gründen die Zeit nicht nutzen, die Sudetendeutschen zu gewinnen, aber auch nicht die Slowaken!, Polen, Ungarn, Ruthenen. Die Wirtschaftskrise, die Not in den sudetendeutschen Industriegebieten, die Tschechisierung ließen keine ruhige Entwicklung zu. Schon die Frage der Arbeitsplätze, der Schulbesuch der Kinder sorgten für dauernde Aufgeregtheit in der Öffentlichkeit. Noch 1938 konnten die Egerer in ihrer Zeitung lesen, daß in der benachbarten, rein deutschen Stadt Asch sechs neue, tschechische Briefträger eingestellt worden seien, aber Deutsche arbeitslos waren. Bei den Wahlen 1935, am Höhepunkt der Wirtschaftskrise, wo in den deutschen Gebieten auf 100 Einwohner 9 - 12 Arbeitslose entfielen, konnte die radikalere Sudetendeutsche Partei - die einen autonomen Status für die Deutschen forderte wie die Slowaken für sich - die Untätigkeit der Regierung in der Zeit der Republik für sich nutzen und fast alle Deutschen auf ihre Seite ziehen.